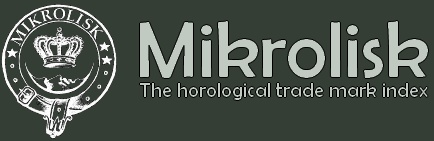| » Aufbau | » Anatomie | » Hemmungen | » Kaliber |
Aufbau einer Uhr
Eine Uhr kann man grob in drei Bereiche einteilen, auch wenn sie sich an den Randstellen überschneiden:
Die Kraftquelle
 Als Kraftquelle dient in der Regel das Federhaus. Das Federhaus ist quasi ein flacher hohler Zylinder mit einer Außenverzahnung
am Boden, der das Räderwerk antreibt. Im Inneren dieses Zylinders befindet sich die Aufzugsfeder, die an einem Haken in der
Federhauswand befestigt ist. Das innere Ende der Aufzugsfeder hängt an einem Haken am drehbaren Federhauskern. In den
meisten Fällen geschieht der Aufzug, in dem der Federhauskern gedreht wird, so daß sich die Aufzugsfeder um den Kern
wickelt. Damit die Kraft nicht wieder über den Federkern an z.B. die Aufzugskrone zurückgegeben wird, sorgt ein Gesperr
gegen eine Rückwärtsbewegung des Federkerns. Bei modernen Uhren ist das Gesperr in der Werksansicht direkt sichtbar,
bei alten englischen Schlüssel- oder Spindeltaschenuhren befindet es sich meist unter dem Zifferblatt versteckt.
Als Kraftquelle dient in der Regel das Federhaus. Das Federhaus ist quasi ein flacher hohler Zylinder mit einer Außenverzahnung
am Boden, der das Räderwerk antreibt. Im Inneren dieses Zylinders befindet sich die Aufzugsfeder, die an einem Haken in der
Federhauswand befestigt ist. Das innere Ende der Aufzugsfeder hängt an einem Haken am drehbaren Federhauskern. In den
meisten Fällen geschieht der Aufzug, in dem der Federhauskern gedreht wird, so daß sich die Aufzugsfeder um den Kern
wickelt. Damit die Kraft nicht wieder über den Federkern an z.B. die Aufzugskrone zurückgegeben wird, sorgt ein Gesperr
gegen eine Rückwärtsbewegung des Federkerns. Bei modernen Uhren ist das Gesperr in der Werksansicht direkt sichtbar,
bei alten englischen Schlüssel- oder Spindeltaschenuhren befindet es sich meist unter dem Zifferblatt versteckt. Da die Kraftabgabe einer Aufzugsfeder keinesfalls linear ist, sondern am Anfang und Ende wesentlich vom halbwegs linearen mittleren
Teil abweicht, war man früh bestrebt, nur den mittleren Teil der Kraftkurve zu nutzen. Hierfür muß:te man
einfach nur die Drehung des Federhauses zum Federhauskern so einschränken, daß von 6 maximalen Umdrehungen nur
die mittleren 4 genommen werden. Dieses läßt sich durch eine Malteserkreuz-Stellung erreichen. Der Stellungsfinger sitzt
dabei auf dem Federkern und dreht das Kreuz solange mit, bis der nach außen gewölbte Kreuzteil einen weiteren Aufzug verhindert.
Beim Ablauf dreht sich das Federhaus um den Kern, somit dreht sich das Kreuz um den Stellfinger herum zurück, bis auch hier der
nach außen gewölbte Kreuzteil ein weiteres Ablaufen verhindert.
Da die Kraftabgabe einer Aufzugsfeder keinesfalls linear ist, sondern am Anfang und Ende wesentlich vom halbwegs linearen mittleren
Teil abweicht, war man früh bestrebt, nur den mittleren Teil der Kraftkurve zu nutzen. Hierfür muß:te man
einfach nur die Drehung des Federhauses zum Federhauskern so einschränken, daß von 6 maximalen Umdrehungen nur
die mittleren 4 genommen werden. Dieses läßt sich durch eine Malteserkreuz-Stellung erreichen. Der Stellungsfinger sitzt
dabei auf dem Federkern und dreht das Kreuz solange mit, bis der nach außen gewölbte Kreuzteil einen weiteren Aufzug verhindert.
Beim Ablauf dreht sich das Federhaus um den Kern, somit dreht sich das Kreuz um den Stellfinger herum zurück, bis auch hier der
nach außen gewölbte Kreuzteil ein weiteres Ablaufen verhindert.Bei recht alten Uhren trifft man jedoch auch auf Werke mit Kette und Schnecke. Hier gibt es ein "Rad", das schneckenförmige Windungen zur Spitze besitzt und eine feine Kette in seinen Windungen aufwickeln kann. Das andere Ende der Kette ist an dem Federhaus befestigt. Sinn dieses Konstrukts ist es, die nicht-lineare Kraftabgabe der Aufzugsfeder im Federhaus auszugleichen, um so einen möglichst gleichmäßigen Gang der Uhr zu gewährleisten. Bei moderneren Uhren ist dieses durch ein anderes Material der Aufzugsfeder und andere Uhrwerksmerkmale gegeben.

Das Räderwerk
Das Räderwerk entspricht quasi einem Übersetzungsgetriebe von langsam (vom Federhaus kommend) zu schnell (Sekundenzeiger oder Gangrad). Für einen gleichmäßigen Ablauf des Räderwerks sorgt am Ende die Hemmung im nächsten Punkt. Das Räderwerk besteht aus einer Kette weniger Zahnräder, wobei der Begriff "Zahnrad" hier eher ein Oberbegriff
ist: Ein solches besteht aus einer Welle, auf dem ein großes Zahnrad und ein kleiner Trieb befestigt sind. Ein solches
Zahnrad wird über den Trieb angetrieben und gibt seine Kraft über das Zahnrad weiter Richtung Hemmungsrad. Insgesamt
besteht das Räderwerk aus:
Das Räderwerk besteht aus einer Kette weniger Zahnräder, wobei der Begriff "Zahnrad" hier eher ein Oberbegriff
ist: Ein solches besteht aus einer Welle, auf dem ein großes Zahnrad und ein kleiner Trieb befestigt sind. Ein solches
Zahnrad wird über den Trieb angetrieben und gibt seine Kraft über das Zahnrad weiter Richtung Hemmungsrad. Insgesamt
besteht das Räderwerk aus:Wenn man es ganz eng sieht, so könnte man die Außenverzahnung des Federhauses hier noch voranstellen.
Die genaue Abfolge ist hier:
Federhausverzahnung » (Minutenradtrieb » Minutenrad) » (Kleinbodenradtrieb » Kleinbodenrad) » (Sekundenradtrieb » Sekundenrad) » Hemmungsrad.
Die Hemmung
Damit das Räderwerk nicht ungebremst (und beschleunigend) abläuft, muß es gehemmt werden. Die Uhrenhemmung war es auch damals, welches erste Versuche des Baus einer Räderuhr immer wieder zunichte machten, bis um 1280 herum die Spindelhemmung erfunden wurde. Heute finden sich überwiegend Ankerhemmungen in mechanischen Uhren, bei älteren Uhren die Zylinderhemmung und bei noch älteren Uhren die Spindelhemmung. Daneben gibt es noch die Chronometerhemmung, die man in Präzisionsuhren manchmal antrifft, und darüber hinaus rund 250 weitere exotische und mehr oder weniger Hemmungen. Auf die einzelnen Hemmungen wird im Hemmungsteil dieser Rubrik
genau eingegangen.
Hemmungsteil dieser Rubrik
genau eingegangen.Das Zeigerwerk
 Das einfache mal zuerst, der Sekundenzeiger. Der Sekundenzeiger steckt direkt auf der Sekundenradwelle des Sekundenrades aus dem
Räderwerk, das sich genau einmal in der Minute dreht. Im Bild rechts ist die aus der Platine kommende Sekundenradwelle durch
einen gelblichen Kreis markiert.
Das einfache mal zuerst, der Sekundenzeiger. Der Sekundenzeiger steckt direkt auf der Sekundenradwelle des Sekundenrades aus dem
Räderwerk, das sich genau einmal in der Minute dreht. Im Bild rechts ist die aus der Platine kommende Sekundenradwelle durch
einen gelblichen Kreis markiert.Interessanter ist jedoch das Zeigerwerk in Hinblick auf Stunden- und Minutenzeiger: Durch die Werksplatine ragt mittig die Minutenradwelle, auf die relativ fest das Viertelrohr aufgeschoben ist (siehe unterer Bildteil rechts). Relativ bedeutet, daß es sich dennoch unabhängig von der Minutenradwelle drehen läßt, um eine Zeigerverstellung zu ermöglichen! Hierbei darf sich ja das Minutenrad im Räderwerk nicht mitdrehen.
Auf das Viertelrohr wird über dem Zifferblatt der Minutenzeiger aufgesteckt, der Minutenzeiger dreht sich also genau mit dem Minutenrad mit. Das Viertelrohr besitzt jedoch auch eine kleine Verzahnung, die ein Wechselrad antreibt (hier links dezentral), das wiederum das Stundenrad bzw. Stundenrohr (mit Verzahnung) antreibt (siehe rechts der obere Bildteil). Darauf sitzt dann über dem Zifferblatt der Stundenzeiger, der also eher indirekt durch den Minutenzeiger angetrieben wird.